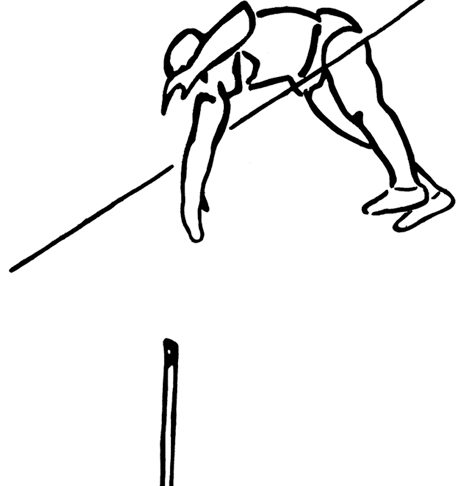Stabhochsprung ist technisch eine komplexe Sportart.
Erfolg beim Stabhochsprung ist aber – wie in jeder leichtathletischen Disziplin – auf hohem und höchstem Niveau von den genetischen Voraussetzungen abhängig.
In der Realität sieht man aber auch Athleten, die genetisch nicht besonders gut ausgerüstet wurden, die aber bemerkenswerte Erfolge feiern können und man sieht Athleten, die genetisch sehr viel Potential hätten, aber beispielsweise bei den Frauen bei 4 Metern stehen bleiben oder bei den Männern bei 5 Metern.
Man sieht Athleten mit technisch versierten Trainern, die ihr Potential nicht realisieren, und man sieht Athleten mit mittelmässig versierten Trainern Erfolge feiern.
Wie lässt sich das erklären und worin gründet nun die Aussicht auf Erfolg?
In der klassischen Erfolgsformel stehen:
- Die Gene des Athleten (darin eingeschlossen die gesundheitliche „Robustheit“),
- die technischen Fähigkeiten des Trainers,
- die Infrastruktur und
- das Umfeld (darin eingeschlossen eine gewisse „finanzielle Sorglosigkeit“).
- das Total der Zeit, wie lange jemand eine Sportart fokussiert trainiert.
Bisweilen findet sich in der Formel auch „die Psyche“, oft im Deckmantel der persönlichen Einstellung, des Willens, des Durchhaltevermögens usw.
Die fünf aufgelisteten Faktoren einer klassischen Erfolgsformel, plus den psychologischen Aspekt, kann ich ausnahmslos bestätigen. Nur ein Faktor bedarf der Präzisierung, die des Trainers. Und dieser Faktor Trainer steht teilweise in Zusammenhang mit dem Faktors Psyche, der oft vergessen wird.
Der Trainer und die Psyche des Athleten sind eng verbundene Erfolgsfaktoren. Was man bei den besten der Welt beobachten kann, geht vom Marionetten-Roboter-Athleten bis zum selbständigen Athleten, der von einem persönlichen Trainer unabhängig handelt und denkt.
Die Summe aus dem Faktor Trainer und dem Faktor Psyche des Athleten muss einen gewissen Mindestwert erreichen, damit man Erfolg hat und dieser Mindestwert liegt sehr hoch.
Es ist aber möglich, dass der wesentliche Teil fast ausschliesslich der Athlet beisteuert, ohne das der Trainer viel beiträgt. Und darauf will dieser Bericht hinaus; dass es am Ende der Athlet ist, der eine bestimmte psychische Eigenschaft haben muss und dass es der Trainer (oder der Athlet selbst) ist, die (zusammen) darauf hinwirken müssen, diese Eigenschaft zu fördern.
Die grundsätzliche psychische „Lebenseinstellung“ des Athleten, wenn er mit der Leichtathletik beginnt, ist im Wesentlichen bereits manifestiert. Ob jemand zum Fallschirmspringer oder zum Buchhalter geeignet ist, ob jemand forsch oder zurückhaltend, ob jemand narzisstisch oder introvertiert ist, entscheidet sich nicht in den Jahren des Stabhochsprungtrainings, sondern zu einem sehr grossen Teil in der frühkindlichen und der kindlichen Entwicklung.
Es gibt Kombinationen von grundsätzlichen psychischen Eigenschaften die ausschliessen, dass jemand jemals ein Weltklasse Stabhochspringer wird. Diese Sportler sind nicht, worauf ich abziele, sondern dienen der Darstellung, dass es zwischen dem „geborenen Weltmeister“ und dessen Gegenteil auch Zwischenstufen gibt. In der sportlichen Laufbahn eines Athleten können immer wieder Phasen zu Tage treten, in welchen sich offenbart, dass die psychischen Eigenschaften der weiteren Leistungsentwicklung im Wege stehen bzw. die Weiterentwicklung der Psyche des Athleten zur Verbesserung der Leistung führen würde; beispielsweise wenn eine Leistungsstagnation eintritt, die mit dem aktuellen körperlichen Potential nicht korreliert, sondern hinter der körperlichen Möglichkeiten zurückbleibt.
Wenn dies der Fall ist (oder starke Anhaltspunkte hierfür sprechen), sollte sich die Weiterentwicklung des Athleten auf eine „Wesensveränderung“ oder einfacher „die Psyche“ konzentrieren. So unmenschlich das klingt, es ist notwendig und auch möglich. Dies zu erkennen und einzuleiten ist wiederum Aufgabe des Trainers.
Damit kommen wir zu einem ganz wesentlichen Punkt, wenn es um die Frage geht, warum Athleten stagnieren – und ob man dem hätte Abhilfe schaffen können und sollen. Ich würde meinen, es gibt unzählige Athleten, die aufgrund ihrer psychischen Veranlagung auf einem gewissen Niveau stagnieren und dann die Lösung nicht bei der Psyche, sondern in mehr Trainingsumfang, neuen Trainingsimpulsen, mehr Krafttraining, einem Trainerwechsel und so weiter suchen und sich dabei bestenfalls nicht steigern und schlechtestenfalls immer öfters verletzt sind und schliesslich die Karriere abbrechen müssen.
Der Trainer, dessen Athlet hinter seinem körperlichen Potential zurückbleibt, hat also zwei Analysefelder. Das eine ist die technische Entwicklung, also die Verbesserung der Stabhochsprungtechnik. Ein Stabhochspringer darf bis ins Alter von 30 Jahren immer hinter seinem genetischen Potential zurückbleiben, wenn man dies technisch begründen kann. Gerade die genetisch meistbegünstigten Athleten haben oft länger an der technischen Entwicklung. Im Sprint bedeuten gute Gene relativ direkt ein gewisses Leistungsniveau. Im Stabhochsprung können gute Gene die Entwicklung auch verlangsamen. Wenn ich mit 8m/s Anlaufgeschwindigkeit Stabhochsprung erlernen will, ist das wesentlich einfacher, als wenn ich mit 9m/s anlaufen kann. Die persönliche Entwicklung bei niedrigerem Geschwindigkeitspotential ist rascher abgeschlossen.
Der zweite Ansatzpunkt sind die psychischen/mentalen Fähigkeiten des Athleten.
Damit wechsle ich zu einem zweiten Aspekt den man ebenfalls zur Psyche zählt, der mit dem „Wesen“ eines Athleten etwas weniger zu tun hat, der aber hierfür auch viel stärker (vom Trainer) beeinflusst werden kann. Es geht um die Selbstbestimmung, die Selbstverantwortung und darum, dass man Stabhochsprung als Athlet lebt.
Bis zu einem gewissen Niveau, sagen wir 4.40m bzw. 5.40m kann ein Team aus einem sehr guten, technisch versierten Trainer und einem Marionetten-Roboter-Athleten funktionieren.
Aber, es irrt wer glaubt, dass ein 5.80m Springer eines diktatorischen russischen Trainers eine blosse Marionette wäre. Selbst die unselbständigste Marionette, die 5.80m springt, hat ein Selbstverständnis von Stabhochsprung, welches das von 90% der Stabhochspringer übertrifft.
Extrembeispiele sind Mondo Duplantis, Renaud Lavillenie, Cornelius Warmerdam. Athleten die ihren Weg selbst gegangen sind und deren Trainer „Begleiter“ im besten Sinne des Wortes waren.
Ein Trainer kann und muss bisweilen in den ersten Jahren der Betreuung eines Athleten ein Antreiber (im psychologischen Sinne), ein Diktator (im Sinne der Bewegungskorrektheit), ein Freund und Ansprechpartner (im Sinne der Freundschaft) sein, aber auf dem Weg zum Erfolg hat er hauptsächlich EINE wichtige Saat zu pflanzen:
„einen selbständigen, selbstverantwortlichen, selbst denkenden Athleten zu entwickeln.“
Sam Kendricks ist 6.06m gesprungen als sein Vater dabei war, 6.02m in Lausanne als sein Vater nicht dabei war. Mondo Duplantis springt seine Weltrekorde mit oder ohne Mama oder Papa, da könnte ein Baumstamm mit einem aufgemaltem Gesicht als Coach dasitzen. Sergey Bubka war ebenso ab 1991, mehr oder weniger selbständig unterwegs.
Ein guter Trainer kann einem Athleten viel beibringen, aber:
„Niemand kann einem Athleten besser sagen, was er beim Springen fühlt, als der Athlet selbst.“
Solange ein Trainer den Versuch unternimmt, alleine anhand seiner Vorstellung dem Athleten eine Anweisung oder ein Feedback zu geben, wird er Mühe bekunden, das Potential des Athleten zu realisieren.
Der Trainer muss darauf hinwirken, dass der Athlet für sich selbst denkt und dabei muss er sich ein Wörterbuch anlegen, wie die Sprache des Athleten sich im Verhältnis zu seiner Sprache verhält. Aus diesem Grund hatte ich bei meinen Athleten jeweils die Devise, dass in den ersten Jahren kein anderer Trainer „dreinredet“, also das niemand von Aussen in dessen Worten meinen Athleten etwas beizubringen oder zu korrigieren versucht, sondern wenn überhaupt, dann über mich, weil ich das Wörterbuch des Athleten am besten kannte.
Ein Beispiel: Ich pflegte während vieler Jahre regen Austausch mit Herbert Czingon über die Entwicklung meiner Athleten – und tue das heute immer noch. Herberts Rückmeldungen wurden praktisch immer via mein Wörterbuch in die Erlebniswelt meiner Athleten übersetzt. Ich würde sagen, mit zunehmender Dauer der Zusammenarbeit handelten fast die Hälfte der technischen Diskussionen mit meinen Athleten davon wie sie etwas meinen, wie sie etwas in Worte fassen, wie ich etwas in Worte fasse und wie ich etwas meine (Vorstellung Athlet in seinem Kopf -> Wortwahl Athlet <-> Wortwahl Coach <- Vorstellung Coach in seinem Kopf).
Ein Athlet hat grundsätzlich schon eine schwierige Aufgabe, wenn er Stabhochsprung erlernen will. Wenn er sich dabei mit „Worten“ und Anweisungen seines Trainers auseinandersetzen muss, bzw. lernen muss zu verstehen, was damit gemeint ist, wenn der Trainer ein Wort benutzt, dann ist das schon schwer genug.
Wenn bevor der Athlet die Anweisungen seines Coaches halbwegs versteht ein anderer Trainer mit anderen Worten „dreinredet“, dann hilft dies in der Regel nicht, sondern die Verwirrung des Athleten nimmt zu. Erfolgreiche Athleten haben in der Regel ihre Basics bei einem (sehr guten) Trainer gelernt. Das ermöglicht ihnen danach, wenn sie ein Grundwissen erarbeitet haben, die Aufnahme von Hinweisen anderer Trainer in ihre Gedankenwelt zu prüfen und dann entweder zu verwerfen oder zu integrieren.
Das ist auch der Grund, weshalb ich grundsätzlich keinen Nutzen sondern vielmehr einen negativen Effekt darin sehe, junge Athleten zu Kaderzusammenzügen einzuladen, wenn dabei etwas über „Stabhochsprungtechnik“ besprochen werden soll. Das kann nur dann zu einem Fortschritt beim jungen Athleten funktionieren, wenn dieser zu Hause einen Trainer hat, der überhaupt keine Ahnung hat. Aber was nützen dann 2-3 Tage Kaderzusammenzüge im Jahr, wenn der Trainer zu Hause dermassen keine Ahnung hat, dass der junge Athlet innerhalb eines Wochenendes tatsächlich begreift, dass der Kader-Trainer ihn besser unterrichtet als der Trainer zu Hause?
Die folgenden Kombinationen zeigen auf, warum es nicht funktioniert, wenn zwei Köche die Suppe salzen:
Trainer sagt A, meint A. Kadertrainer sagt A, meint aber B. Athlet versteht A – Kadertrainer meinte aber B. Das Chaos im Kopf des Athleten ist perfekt.
Und in etwas komplizierterer Version: Trainer und Athlet erarbeiten ein System A, bestehend aus den Elementen, 1, 2, 3 und 4. Der Kadertrainer will Element 2 besprechen und hat dabei eine Ansicht, die nicht mit den Elementen 1, 3 und 4 des Athleten passend gemacht werden kann, bzw. es macht keinen Sinn für diesen Athleten, dem Kadertrainer zu Element 2 zuzuhören und daran etwas zu ändern, weil dann 1, 3, 4 nicht mehr dazu passen. Im besten Fall erkennt der Athlet die Unstimmigkeit, im schlechteren Fall wirft der Kadertrainer die Entwicklung des Athleten zurück.
Das Richtige zu wissen und beibringen zu wollen, ist die Aufgabe jedes Trainers. Aber als externer Trainer B, dem Trainer A möglicherweise zu widersprechen ist in der Regel kritisch. Denn ein Grundprinzip beim Stabhochsprung ist: Der Athlet muss seinem Trainer immer vertrauen können. Wenn der Athlet merkt, dass der Kadertrainer mehr weiss, wie der eigene Trainer, was dann? Logische Antwort: Entweder mit dem Sport aufhören oder den Trainer wechseln. Oder der Athlet ist so „bescheiden“, dass er, obwohl er in einem Kader ist, damit vorlieb nimmt, weiter von seinem Trainer zu lernen, der ihn nicht so gut fördert, wie das ein anderer Trainer könnte. Diesen Weg wählen nicht nur bescheidene Athleten, sondern auch solche, die gerne in ihrer Comfort-Zone verharren. Ein Champions hingegen sucht sich den besten Coach.
Der richtige Weg, wenn ein Trainer mehr weiss wie der andere ist der, dass der eine Trainer den anderen ausbildet, ohne dass die Athleten des letzteren dies zu sehr merken.
Damit zurück zum Thema, den eigenen Weg zu finden beim Stabhochsprung.
Der Grund, weshalb Mondo Duplantis bereits in jungen Jahren grosse Erfolge feiert ist, dass er sich seit jeher Gedanken um Stabhochsprung gemacht hat, das er sich seit Kindesalter ein Gefühl erarbeitet hat, Trial-and-Error durchgespielt hat und seinen Weg gefunden hat.
Bei Athleten, die stagnieren, ist hauptsächlich danach zu fragen, wie es um ihre Selbstvorstellung von Stabhochsprung und ihre Selbstverantwortung für ihre eigene Leistungsentwicklung steht.
Machen sie bloss was ihr Trainer sagt, oder hilft ihnen der Trainer bei der Selbstentwicklung. Meiner Meinung nach stagnieren die meisten Athleten, weil Stabhochsprung für sie ein Bewegungsablauf ist, von dem ihnen ihr Trainer zu sagen hat, wie der gehen sollte. Anstatt dass sie sich selbst der Sache annehmen und ihnen dabei der Trainer hilft.
Wenn mir ein erfahrener Athlet sagt : „Meinem Trainer ist [dieses Element des Bewegungsablaufs] sehr wichtig“, dann stehen mir die Haare zu Berge. Ein Element oder eine Bewegungsausführung sollte nicht deshalb „wichtig“ oder „richtig“ sein, weil es dem Trainer wichtig ist, sondern weil es der Athlet (auch) so empfindet. Wenn man Renaud fragt, weshalb er so springt wie er springt, dann antwortet er in eigenen Worten und nicht mit den Worten, das ein Trainer X, das wichtig oder richtig findet. Mondo antwortet auf die Frage, weshalb er den Stab so aggressiv mit dem unteren Arm attackiert: „Weil mir das das Gefühl gibt, dass ich jeden Stab der Welt springen kann.“ Er antwortet nicht: „Mein Vater findet das richtig so.“
Korrekt ist natürlich auch, wenn der Athlet sagt: „Meinem Trainer war XY wichtig und ich habe festgestellt, dass mir das tatsächlich etwas bringt und deshalb mache ich das nun so.“
Athleten, die selber denken, die dürfen nicht nur, die sollen sich gerade zu Kaderzusammenzügen, zu Trainingsweekends mit anderen Gruppen und Trainern usw. treffen. Denn solche Athleten haben ein gefestigtes Selbstbild ihrer Technik und können sodann nur davon profitieren, ihr Selbstbild durch neuen Input zu bereichern, Input zu prüfen, zu verwerfen oder zu integrieren.