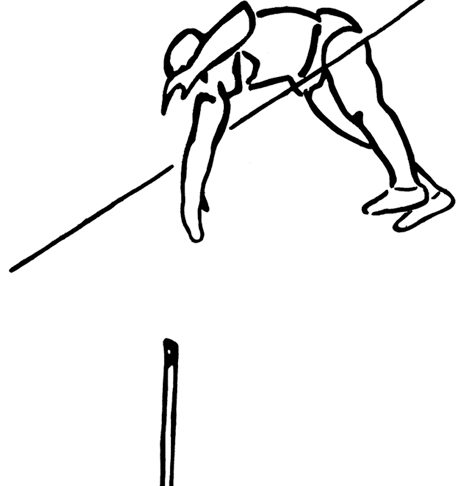Prof. Karl A. Ericsson (Peak) zeigt in seinen wissenschaftlichen Arbeiten auf, dass der Umfang des intensiven selbständigen Lernens (deliberate practice) den Unterschied macht zwischen Durchschnitt, überdurschnittlich und der Spitze in einer bestimmten Fähigkeit (Musik, Sport, Beruf). In seinen Studien untersuchte er hauptsächlich Musiker der Berliner Philharmonie und deren Ausbildungsweg. Musiker üben überweigend alleine an ihrem Instrument.
Wie überträgt man diese Erkenntnisse auf Stabhochsprung oder Sport ganz allgemein?
Zunächst kommt es auf die Sportart an. Ein Basketballspieler trifft den Korb besser, wenn er 5 Tage die Woche 3 Stunden Würfe trainiert. Alleine. Dazu braucht er nicht ständig die Präsenz eines Coaches.
Aber Stabhochsprung?
Früher war meine Meinung, dass wenn der Coach 5x pro Woche auf dem Platz steht, ist es besser als wenn er 4x pro Woche auf dem Platz steht. Weil Stabhochsprung so komplex ist und jeder Fehler, der sich im Training einschleicht, nur mit einem Mehrfachen an Aufwand wieder zu korrigieren ist.
Diese Meinung hat sich nicht geändert, aber sie hat eine Ergänzung erfahren. Hausaufgaben und alleiniges Training sind auch im Stabhochsprung möglich.
Ich beginne meine Erklärung mit den Nachteilen der Anwesenheit eines Coaches:
Der Athlet verlässt sich auf den Trainer.Der Trainer sagt mir (Athlet), was zu tun ist, wie es zu tun ist, und ich mache einfach. Das ist für einfache stereotype Bewegungen richtig. Man automatisiert, was der Trainer einem beibringt. Dieser Automatismus funktioniert. Zum Beispiel erlernt man so einen Überschlag, einen Salto.
Wenn es aber um komplexere Bewegungsabläufe geht, funktioniert dieses Prinzip nicht. Willkommen beim Stabhochsprung. Das Zusammenspiel von Anlaufgeschwindigkeit, Biegen eines Stabs, und Orientierung in der Luft ist so komplex, dass man nicht mit einfachen Anweisungen ans Ziel kommen kann. Man kann nicht einem Athleten gleich einem Roboter kleine Programme einpflanzen und irgendwann springt er dann 5.50m. Bei den meisten Athleten würde das alleine schon an der „Angst“ scheitern. Der Mensch ist auf Überleben programmiert. Er führt nicht einfach Bewegungen aus, die ihm ein Trainer beibringt und die ihn in Lebensgefahr bringen.
Jeder Stabhochspringer muss seinen eigenen Lernweg gehen, muss sich den Bewegungsablauf erarbeiten.
Und hier kommt das Element des selbständigen Übens ins Spiel.
Der Athlet springt, weil es der Trainer so will. Manchmal kommen Athleten müde von der Schule oder nicht motiviert ins Training, weil etwas in ihrem Leben nicht passt oder sie beschäftigt. Dann springen sie in der Regel hauptsächlich, weil Springen auf dem Programm steht und ein Trainer da steht, der etwas erwartet. Diese Art des Lernens ist die schlechteste Form.
So lernte ich französisch in der Schule. Da steht jemand und will was von mir, was ich gerade nicht so richtig will, auch wenn’s schön wäre, wenn ich das einfach könnte.
Was würde der Athlet tun, wenn kein Trainer da wäre und Springen nicht auf dem Programm stehen würde? Nicht springen, richtig. Und vermutlich wäre das auch das Gescheiteste. Springen sollte wann immer möglich hauptsächlich intrinsisch motiviert sein und nur zu einem Bruchteil extrinsisch.
Was nicht schadet, ist wenn der Athlet einmal einen härteren Stab nimmt, weil der Trainer ihn dazu motiviert oder dass die Teamkollegen das Quentchen Motivation beisteuern, noch einen Sprung mehr zu machen. Diese Form der extrinsischen Motivation ist sehr wichtig. Im Kern muss aber der Athlet motiviert im Training erscheinen.
Der Bogen zum selbständigen Training ist nun schnell gespannt. Einem Athleten auftragen, ein technisches Detail zu trainieren, ohne dass der Trainer daneben steht. Zum Beispiel an der Einstichbewegung arbeiten bei Sprüngen in den Sand oder auf die Matte. Der Athlet soll selbständig 15-20 Sprünge machen und sich dabei filmen lassen.
Diese Form des selbständigen Trainings hat folgende positiven Effekte:
- Der Athlet befasst sich mit seiner Bewegungsausführung
- Der Athlet sieht sich selbst Verantwortlich dafür, einen Teil der Aufgabe selbst zu lösen
- Der Athlet muss sich selbst prüfen und korrigieren
- Der Athlet kann 0% auf den Trainer abschieben, er kann sich auf niemand anderen verlassen.
- Er muss selbst motiviert sein.
Wichtig, dass diese Art der Aufgabenstellung funktioniert ist, dass die Aufgabe machbar ist. Woran der Athlet selbständig arbeiten soll, muss für ihn erkennbar sein, d.h. er muss auf seinem Handy auf dem Video von sich selbst erkennen können, ob er es richtig oder falsch macht und er muss vom Trainer wissen, was er tun muss, damit es richtig wird. Wenn diese Parameter gegeben sind, spricht nichts gegen selbständiges Training. Im Gegenteil die Selbstwirksamkeit und die Kompetenz des Athleten erhöht sich und man hat den netten Nebeneffekt, dass sich die Spreu rascher vom Weizen trennt, sprich die intrinsisch Motivierten rascher weiter kommen und die weniger motivierten merken, dass wenn der Trainer nicht ist, ihnen selbst gar nicht so sehr am Training liegt und sie lieber was anderes machen.
Das selbständige Lernen hat einen weiteren Anwendungsbereich, die Verfestigung. Ein Basketballspieler kann seine Wurfpräzision, seine Trefferquote bestens alleine trainieren. Da steht kein Trainer daneben und sagt, das nächste mal etwas weiter links, das nächste mal etwas höher, dann triffst du. Oder bei der Prazision bei einem Salto. Die x-fache Wiederholung bis ein Turnelement „im Schlaf“ funktioniert, das kann der Athlet alleine bewerkstelligen.
Hier haben wir Stabhochspringer Nachholbedarf. Eine Latte auflegen und eine Bewegung wie ein chinesischer Kunstturner einfach 20x wiederholen. Nicht mit dem Ziel etwas zu verbessern, sondern einfach 20x eine Höhe zu springen, z.B. 20cm unter der Bestleistung, dafür ohne Wenn und Aber. Denn das bringt die Stabilität in den Bewegungsablauf, die den Freiheitsgrad zulässt, um am Wettkampf über sich hinauszuwachsen.