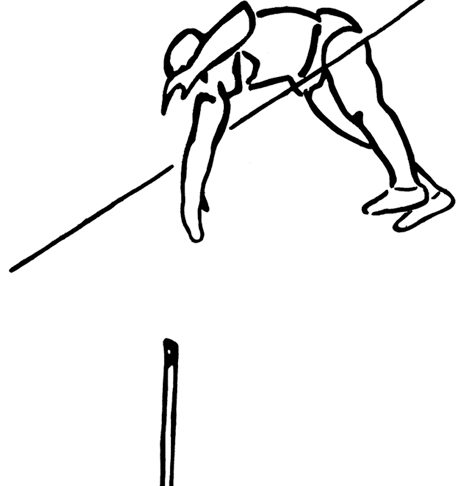Videoaufnahmen sind beim Stabhochsprung ein wichtiges Arbeitsinstrument für Coach wie Athlet.
Dieser Beitrag befasst sich mit den Tücken der Videoanalyse, genauer mit Super-Zeitlupen und Standbildern.
Leichtathletik = Energie
Energie = Geschwindigkeit (kinetische Energie) oder Höhe (potentielle Energie). Es geht in der Leichtathletik in der Regel darum, gegenüber dem Erdboden eine möglichst hohe kinetische Energie, also Geschwindigkeit, zu generieren oder potentielle Energie, sprich Höhe, zu erreichen oder eine Kombination von beidem.
Um diese Art von Energie zu gewinnen, baut der Athlet auf das Prinzip «actio = reactio.» Ohne Fussabdruck am Boden kein Gewinn an kinetischer oder potentieller Energie (auch nicht in den Wurfdisziplinen). Ich stosse in den Boden, der Boden stösst mich ab, ich gewinne an Höhe oder Geschwindigkeit (oder das Wurfgerät gewinnt an Energie).
Einem Video-Standbild kann man keine Bewegung entnehmen. Mit Erfahrung kann man aus dem Standbild schliessen aufgrund welcher Bewegungen der da abgebildete Mensch in die da abgebildete Position gelangt ist. Der Unkundige kann nicht einmal das.
Dem Ausserirdischen, der zu Besuch auf der Erde ist, sagt ein Bild eines Erdbewohners, der an einem Stab hängt gar nichts. Ein Stabhochsprung-Video lässt ihn verstehen, worin das Ziel der Tätigkeit liegt.
Wir halten einmal fest: Der Experte kann einem Video-Standbild viel mehr entnehmen als der Anfänger. Das bleibt in Erinnerung zu behalten, wenn es darum geht, dem Anfänger ein Standbild seines Sprunges zu zeigen.
Der Anfänger hat nicht die Fähigkeiten zur Interpretation eines Standbildes, wie das der Trainer oft annimmt. Während dem Trainer vieles klar scheint, während er etwas anhand eines Standbildes erklärt, versteht der Anfänger unter Umständen gar nichts davon. Wieviel ein Athlet von einer Videoanalyse profitieren kann, muss der Trainer abschätzen können.
Aber auch der Experte und der Fortgeschritten können aus einem Standbild nicht alles Relevante herauslesen, insbesondere nicht beim Stabhochsprung – und damit zum Kern dieses Beitrags.
Meine Beobachtung ist, dass (zu) viele Trainer und Athleten die Technik ihrer Athleten bzw. von sich selbst durch die Analyse von Superzeitlupen oder Standbildern beurteilen.
Der Grund hierfür liegt meines Erachtens in Folgendem:
Mit Echtzeitvideos sind viele überfordert. Es bedarf des jahrelangen Studiums des Stabhochsprungs, Bewegungen in Echtzeit zu erfassen und beurteilen zu können.
In Echtzeit sieht man nicht Positionen, sondern eine Bewegungsabfolge. Mit dem Thema Sprungrhythmus (actio und reactio zwischen Stab und Springer) sind viele Trainer und Athleten überfordert. Es ist bedeutend einfacher, Standbilder von Sprungpositionen von Vorbildern mit seinen eigenen Positionen zu vergleichen und sie gleichsam geistig übereinander zu legen. „Hier sollte ich etwas mehr dies, da sollte ich etwas mehr so sein, usw.“
Es ist relativ einfach, die Unterscheide zwischen zwei Standbildern zu erkennen (der Profi und man selbst in „derselben“ Position), Umso schwierig ist es, als Trainer zu verstehen und zu erklären oder als Athlet zu verstehen, wie der Sprungrhythmus sein sollte.
Was meine ich damit? Stabhochsprung ist nicht das Aneinanderreihen perfekter Standbilder (das sogenannte Serienbild, das in gewisser Weise symptomatisch ist). Wer eine Position nach der anderen perfektioniert, hat keine Garantie jemals richtig hoch zu springen, denn eine Position kann mit oder ohne Dynamik geturnt werden. Stabhoch ist ein Bewegungsablauf, eine Dynamik, ein Energiefluss.
Dynamik ist beispielsweise: Wie aus der Bewegung auf den letzten Schritten des Einstichs die Bewegung des Absprungs beeinflusst wird; wie das Timing des Absprungs, die Aufrollbewegung beeinflusst; wann ein Stab aufgrund der Bewegungsaktivität des Athleten in Relation zu seiner Griffhöhe als zu weich erscheint; wann ein Stab zu hart erscheint, um einem Athleten eine gewisse Bewegung zu ermöglichen; wann jemand eine Sprungphase zu hastig oder über Gebühr lange ausführt.
Schaut man sich die Weltklassespringer an, findet man in Standbildern «Fehler» zu Hauf. Man fragt sich oft, wieso springen die alle so hoch, wenn sie doch hier und dort Mängel offenbaren?
Was dabei gerne übersehen wird, ist, dass Stabhochsprung in sehr ausgeprägter Form die Fähigkeit zur Transformation von Energie voraussetzt: von der Anlaufgeschwindigkeit über den Transfer der Energie auf den Stab und wieder zurück auf den Athleten, von der Horizontalen in die Vertikale, von Schwung zu Streckung.
Ein Springer läuft an und das Ziel ist, maximale Höhe zu generieren. Dafür benötigt man beim Verlassen des Stabes maximale kinetische Energie in der Vertikalen, plus eine zeitlich abgestimmte Rotationsbewegung, damit man über die Latte springt, ohne diese dabei zu berühren.
Was man also auch immer tut, von der Einstichbewegung bis zur Lattenüberquerung, hat diese beiden Ziele zu verfolgen. Dabei geht es in erster Linie um Dynamik und damit Bewegungsrhythmus und nicht um das strebsame Anpeilen perfekter Bewegungsausführung.
Dies ist gerade bei Frauen oft zu beobachten: Aus dem schulbuchmässigen Erlernen von Positionen wird Erfolg erhofft – aber damit ist es nicht getan. Dann kommt eine Athletin daher, die 1m/s schneller anläuft und sich mit aller Gewalt in den Stab hineinwirft und „oh Wunder“, die springt dann mit einer „grässlichen“ Technik einen halben Meter höher als die Musterschülerinnen. Das ist mein Exempel dafür, worauf es im Stabhochsprung ankommt. Ich würde die Technik von Sandi Morris oder Katie Nageottie nicht in ein Techniklehrbuch aufnehmen, aber ich würde den beiden ein ganzes Kapitel widmen, um aufzuzeigen, worauf es im Stabhochsprung darauf ankommt: Energie bzw. Power.
Das Standbild verhilft also nicht zum Seelenheil. Es ist hilfreich, wenn die einzelnen Positionen «schön» aussehen. Aber es gibt Springer, bei denen 90% der Positionen «schön» aussehen, aber es wird nicht die erhoffte Höhe generiert, weil sie im entscheidenden Moment sehr viel Energie aus dem System entlassen (z.B. Absprung/Einstich-Komplex) oder weil der Bewegungsrhythmus nicht stimmt und die Latte gerissen wird, obwohl die potentielle Höhe hinreichend wäre. Oder ganz einfach, weil um die richtige Bewegungsausführung zu gewährleisten die Anlaufgeschwindigkeit gedrosselt wird. Die Geschwindigkeitsenergie beim Absprung ist aber immer einer der entscheidenden Faktoren im Stabhochsprung.
Ein einfaches Beispiel: Der Springer kommt in eine ordentliche L-Position, also eingerollt mit Schienbeinen auf Höhe der oberen Hand. Dieses Standbild sagt in der Regel wenig aus. Denn es kann sein, dass in dem Moment die dynamische Bewegung des Springers gerade endet, er also nicht mehr die Hüft hochschieben kann, sondern zur Latte «ausleert.» Das wiederum kann eine Vielzahl von Gründen haben, die man in einem Echtzeit-Video oder einer schnelleren Zeitlupe erkennen könnte, aber nicht im Standbild. Da sieht man nur plötzlich beim nächsten Bild, dass etwas nicht mehr stimmt. Aber nicht warum.
Für mich ist ein Video in etwa 38 bis 66 % Geschwindigkeit das beste Instrument, einem Athleten beizubringen, zu erklären , wie er die Dynamik, den Rhythmus des Sprungs getroffen hat. Es bietet sich auch an, zwischen Zeitlupen-Geschwindigkeiten hin- und her zu switchen.
Beispiel dynamischen Springens: Sam Kendricks. Man nehme die Standbilder von Sam Kendricks beim Absprung und in der L-Position. Die Lehrbücher sagen da was anderes. Auch die Griffhöhe mit knapp 4.90m weit unter Durchschnitt für einen 6-Meter-Springer. Was macht der Mann also richtig, wenn er so viel falsch macht und dabei nicht einmal auf eine gescheite Griffhöhe kommt? Er entwickelt eine sensationelle Dynamik.
Am Ende kann es Trainer und Springer egal sein, wenn ein Athlet beim Einrollen den Kopf in den Nacken nimmt (wie Kendricks) und dafür die Diamond League gewinnt. Mit der Frage, ob Sam Kendricks ohne Kopf im Nacken noch höher springen würde, kann man sich schon beschäftigen, aber ich hätte gerne zwei bis drei 5.90m Springer im Lande, die den Kopf in den Nacken nehmen, dafür im Übrigen sehr gut begriffen haben, dass es im Stabhochsprung darum geht, Dynamik zu produzieren und nicht schöne Standbilder.
Wir Stabhochspringer sind Leichtathleten, keine Kunstturner. Der Glaube, gute Kunstturner würden gute Stabhochspringer hält sich hartnäckig. Bis auf ein Niveau von 5.00m und 4.00m lässt sich tatsächlich feststellen, dass ehemalige Kunstturner dieses Sprungniveau in überproportional vielen Fällen leichter erreichen, als Nicht-Kunstturner. Aber wenn es darum geht, 6.00m und 5.00m zu springen, ist Anlaufgeschwindigkeit und Bewegungsdynamik die relevante Komponente.
Power, Explosivität plus vernünftige technische Qualität schlägt nun einfach einmal turnerischen Schöngeist.
Damit will ich nicht sagen, dass beim Anfänger mehr auf Power geachtet werden soll, als auf eine korrekte technische Ausführung. Es geht mir vielmehr darum, dass beim Springen mit sich biegendem Stab verstärkt dem Faktor Dynamik und Rhythmus Beachtung geschenkt wird. Stabhoch wurde sehr lange mit starrem Stab gesprungen. Diese Tatsache und der grosse Einfluss der russischen Stabhochsprungschule führten zu einer meines Erachtens übertriebenen Fokussierung auf die Technik am starren Stab im Anfängerbereich und als Grundlage bzw. Vorbereitung auf das Springen mit sich biegendem Stab. Das Mantra, dass man am sich biegenden Stab „gleich“ springen sollte, wie am starren Stab, stelle ich in Frage.
In jüngerer Vergangenheit zeigen uns Stabhochsprungartisten vieler Couleur auf, was man aus einem gebogenen Stab herausholen kann. Ich nenne diese Athleten mit Absicht Artisten, weil sie bei der Bewegung am und mit dem Stab in gewisser Weise Kunst betreiben. Romain Mesnil, Renaud Lavillenie, Ninon Gouillon-Romarin, Mondo Duplantis, Axel Chapelle und einige mehr, holen aus ihren Arbeitsgeräten heraus, was nicht im Ansatz wie Springen am starren Stab aussieht. Sie sind langsam (Mesnil), haben tiefe Griffhöhen (Chapelle), sind nicht kräftig (Gouillon-Romarin) oder springen „zu“ weit ab mit extremer Biegung (Lavillenie), was der Lehre der Continous Chain von Botcharnikov so gar nicht entspricht, und alle sind damit sehr erfolgreich in Relation zu ihren physischen Möglichkeiten (Körpergrösse und Anlaufgeschwindigkeit).
Das Ziel sollte deshalb meines Erachtens zuerst ein rudimentär richtiger Bewegungsablauf sein, mit dem richtigen Rhythmus. Ebenso sollte nicht blind auf die richtige Ausführung von Übungen am starren Stab geachtet werden und dabei das Erlernen des Gespürs eines sich biegenenden Stabes ausser Acht gelassen werden.
Damit sind wir zurück bei einem bereits besprochenen Thema: Expertise. In einer bescheidenen Ausführung eines Anfängers zu erkennen, aber in puncto Rhythmus auf dem richtigen Weg ist, ist schwierig. Das enthebt aber keinen Trainer davon, von diesem Lernprinzip abzuweichen, sondern soll den Trainer herausfordern, seine Fähigkeiten zu verbessern. Ich sehe oft Anfänger, die, wenn sie den Sprungrhythmus gerade gar nicht schlecht getroffen haben, von ihren Trainern Rückmeldungen zu diesem und jenem erhalten, was der Athlet noch gar nicht begreifen kann. In solch einem Moment wäre es der Sache dienlicher, den Athleten einfach einmal weiter machen zu lassen. Wenn der Rhythmus stimmt, soll er diesen zuerst einmal stabilisieren – und dazu reichen 5 Sprünge nicht aus. Im Übrigen ist der Athlet nicht dumm. Es ist für den Anfänger oder Fortgeschrittenen nicht schwierig, den Unterschied zwischen seinen Positionen (Standbildern) und denen der Profis zu erkennen. Aber die Qualität seines Sprungrhythmus zu beurteilen, dazu ist er ausser Stande, das ist der Job seines Trainers. Kann der Trainer dies nicht gewährleisten, hat der Athlet ein Problem, denn dann steuert das Schiff ohne klaren Kurs auf offener See.
Athleten sind oft unzufrieden mit ihren Standbildern. Dann zeige ich ihnen die Sprünge immer nochmals in Echtzeit, um aufzuzeigen, dass sie auf dem richtigen Weg sind (falls sie auf dem richtigen Weg sind!). Athleten dürfen unzufrieden mit Standbildern sein (sollen sie auch), aber sie müssen lernen, dass in erster Linie der Rhythmus, der Gesamtablauf stimmig sein muss. Es geht am Ende nicht darum „schön“ zu springen, sondern hoch (siehe Morris und Nageottie). Es gibt keine Noten für schönes Springen und wo der Fokus auf Technik die Dynamik bremst, muss man sich des Trade-Offs bewusst sein.